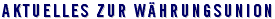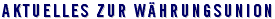|
Die Einigung auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt, auf den
sich die Staats- und Regierungschefs am ersten Tag des
Europäischen Rates von Dublin verständigen konnten, ist in der internationalen Presse kontrovers kommentiert worden. Vornehmlich ging es dabei um die Frage, ob sich die deutsche oder französische Position durchgesetzt habe. Nachfolgend haben wir einige Beiträge zusammengefaßt.
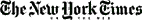
14. Dezember 1996. »
Das Ergebnis stellt einen Kompromiß zwischen Deutschland,
dessen Vertreter entschlossen waren, die Sicherheit ihrer geliebten
DM auf den Euro auszuweiten, und den meisten anderen
europäischen Staaten dar, die eine Ausnahmeregelung für
spezielle Umstände forderten. Der Plan mag in der Praxis
funktionieren oder nicht, aber es ist immer noch möglich,
daß das Projekt letztendlich scheitert bevor es überhaupt
gestartet worden ist. Die fast einhellige Meinung unter den
Finanzexperten ist, daß der Euro wahrscheinlich pünktlich
zum 1. Januar 1999 starten wird und das wenigstens acht Staaten,
geführt von Deutschland und Frankreich, von Beginn an teilnehmen
werden.
«
The New York Times

14. Dezember 1996. »
Die Vereinbarung über solide Staatshaushalte schließt
zugleich die technischen Vorarbeiten für den Euro weitgehend ab.
Dazu gehören außerdem ein Wechselkurssystem zwischen dem
Euro und den vorerst an der Gemeinschaftswährung nicht
teilnehmenden Staaten (EWS II) sowie Verordnungen über den
Rechtsstatus der EU-Währung. Gleichwohl blieben
Meinungsunterschiede zwischen den EU-Partnern bestehen. Waigel
betonte, man habe eine 'Quasi-Automatik' für die Verhängung
von Geldbußen bei Überschreitung der vom Vertrag gesetzten
Grenze für die Neuverschuldung erreicht. Demgegenüber
äußerte Jacques Chirac, es gebe 'keinen Automatismus'.
«
Handelsblatt
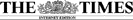
16. Dezember 1996. »
Frankreich hat zwei entscheidende Siege errungen. Durch den
Maastrichter Vertrag selbst wurde die Wechselkurspolitik des Euro zu
einer Angelegenheit des Ministerrates, der mit qualifizierter
Mehrheit entscheidet. Der Gipfel von Dublin legte nun fest, daß
Strafen, die aus dem Stabilitätspakt resultieren, durch den Rat
der Finanzminister bestimmt werden, ebenfalls unter Anwendung der
qualifizierten Mehrheit. Dieses ist kein unabhängiger Euro; der
Wechselkurs und die Finanzpolitik werden politisch durch den
üblichen Verhandlungsprozeß zur Erreichung von Mehrheiten
im Ministerrat entschieden.
«
The Times Internet Edition

13. Dezember 1996. »
Bei der Debatte um einen europäischen Stabilitätspakt
standen sich zwei konträre geld- und finanzpolitische
Grundsatzauffassungen gegenüber. Der deutschen Linie ging es vor
allem um die Stabilität und das Vertrauen der Finanzmärkte
in die künftige europäische Währung. Die
französische Position wollte einen etwas weicheren Euro, um
damit die Exportaussichten der europäischen Industrie zu
verbessern. Bundesregierung und Bundesbank sahen sich in den
vergangenen Wochen einer fast geschlossenen Front von Weichmachern
gegenüber. Unterstützung für Bundesfinanzminister Theo
Waigel gab es nur von den Niederlanden und mit Abstrichen auch von
Luxemburg, das freilich auf seinen Nachbarn Frankreich Rücksicht
nehmen mußte.
«
Süddeutsche Zeitung

14. Dezember 1996. »
Deutschland drängte den Rest der Europäischen Union,
sich einem strengen Haushaltsstabilitätspakt für die
zukünftige Euro-Zone anzuschließen, der nahezu
automatische Sanktionen gegen die Anhäufung eines exessiven
Defizits androht.
«
Financial Times

15. Dezember 1996. »
Die Schwierigkeiten, unter denen die Einigung von Dublin zustande
gekommen ist, bergen die Gefahr, das Narben bleiben. Die Probleme
haben auf beiden Seiten des Rheins Vorbehalte genährt und
unterstreichen die Schwäche der Institutionen der Gemeinschaft
zur Steuerung der Währungsunion. Es wird die Aufgabe der
Regierungskonferenz werden, hier nachzubessern. Auf jeden Fall wird
des schwierig, einer von fortdauernder Arbeitslosigkeit
geängstigten Öffentlichkeit die Vision eines strikt
monetaristisch ausgerichteten Europa zu vermitteln.
«
Le Monde
![The Wall Street Jounal [Europe]](graphics/press/wsj.gif)
16. Dezember 1996. »
Der Stabilitätspakt, durch den die Mitgliedstaaten
riskieren, hohe Strafen zahlen zu müssen, wenn ihr
Haushaltsdefizit die Marke von 3 Prozent des BIP überschreitet,
wurde zuerst im vergangenen Jahr von Deutschland vorgeschlagen. Sie
beharrten auf einem solchen System, um die eigene Öffentlichkeit
und die Märkte davon zu überzeugen, daß eine geringe
Inflation beibehalten werde, wenn der Euro die DM ersetzt. Frankreich
widersetzte sich mit überwältigender Unterstützung der übrigen Staaten , akzeptierte aber schließlich den Stabilitätspakt mit dem Zugeständnis, Politiker, nicht Bürokraten würden entscheiden, wann derartige Strafen verhängt werden.
«
The Wall Street Jounal [Europe]

16. Dezember 1996. »
Den Streit, der die Finanzminister Europas etliche Stunden Schlaf
kostete und der den Terminplan des Gipfels durcheinander brachte,
hatte Theo Waigel mit nach Dublin gebracht. Bis zuletzt bestand der
Deutsche darauf, daß automatisch bestraft wird, wer die
Drei-Prozent-Verschuldungsgrenze überschreitet. Die Franzosen
verlangten, daß die Situation, in der sich der Sünder
befinden könnte, berücksichtigt werden müsse. Genau
das wollten die Deutschen verhindern. Wie die Franzosen waren alle
anderen Partner der Meinung, daß der Deutsche diesmal in seinem
Bestreben, den Euro vor jeder Gefahr zu schützen, zu weit gehen
wollte. Mit seiner Unnachgiebigkeit hatte Waigel besonders seinen
französischen Kollegen Jean Arthuis schon vor dem Gipfel ernste
Probleme bereitet. Die Franzosen sind es leid, bei der Einführung der gemeinsamen Währung immer nur treu bei Fuß zu gehen. Und die Pariser Regierung kann es sich nicht leisten, weiterhin den Deutschen in allem nachzugeben.
«
Der Spiegel

20. Dezember 1996. »
Wochenlang hatten sich Paris und Bonn in einen Streit um den
Stabilitätspakt verkeilt; noch am Donnerstag, so erzählt
ein Augenzeuge, war die Dubliner Krisensitzung der Finanzminister 'zu
einer Art Kulturkampf' ausgeartet. Deutsche 'Stabilität'
verlangte nach 'automatischen Sanktionen' für Schuldenmacher,
französische 'Souveränität' forderte 'das letzte Wort
für die Politik'. Mehr hatten sich Theo Waigel und sein
französischer Widersacher Jean Athuis kaum noch zu sagen.
Daß die Verhandlungen um den Euro nicht platzten, war anderen
zu verdanken, vor allem Jean-Claude Juncker, dem luxemburgischen
Premier und Finanzminister. Der betrieb stundenlang Seelenmassage und
entwarf schließlich jene Kompromißformel, die Jacques und
Helmut, der Lange und der Dicke, tags drauf mit Handschlag
besiegelten.
«
Die Zeit

14. Dezember 1996. »
Die nach vielen Stunden von Verhandlungen erreichte
Übereinkunft beinhaltet etwas für beide Seiten. Für
die Deutschen, und jene die ihre Ansicht teilen, stellt sie sicher,
daß ein strenges fiskalisches Regime die Einführung des
Euro begleitet. [...] Für die Franzosen, und alle die ihre
Auffassung teilen, erlaubt es der Kompromiß, daß
politische Beratungen angesetzt werden, wenn es darum geht, auf
wirtschaftliche Krisensituationen zu reagieren. (...) Es kann kein
Zweifel darüber bestehen, daß diese Übereinkunft ein
Meilenstein in dieser kritischen Phase des Projektes darstellt.
«
The Irish Times

21. Dezember 1996. »
Obwohl Herr Waigel immer noch darauf besteht, daß die
Vereinbarung eine "Quasi-Automatik" beinhalte (was auch immer das
bedeutet), hat sich Frankreich mehrheitlich durchgesetzt. Die neuen
Regeln gewähren den Staaten tatsächlich automatische
Absolution sofern ihre Wirtschaft um mehr als zwei Prozent schrumpft.
Und sie können immer noch das Vorhandensein einer
außergewöhnlichen Situation geltend machen, wenn sich ihre
Wirtschaft überhaupt rückläufig entwickelt, obwohl die
Resolution aussagt, daß der Rückgang des BIP mindestens
0,75 Prozent ausmachen müsse, bevor Nachsicht geübt werden
könne. Sanktionen, etwa die Überweisung von
Strafgebühren in Höhe von 0,5 Prozent des BIP, müssen
darüber hinaus vom Ministerrat genehmigt werden.
«
The Economist
 Meldungen 1996 Meldungen 1996
Top-Thema
| Aktuell
| Termine
| Bücher
| Links
| Archiv
Home
| Feedback
| Impressum
|